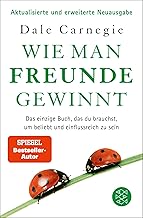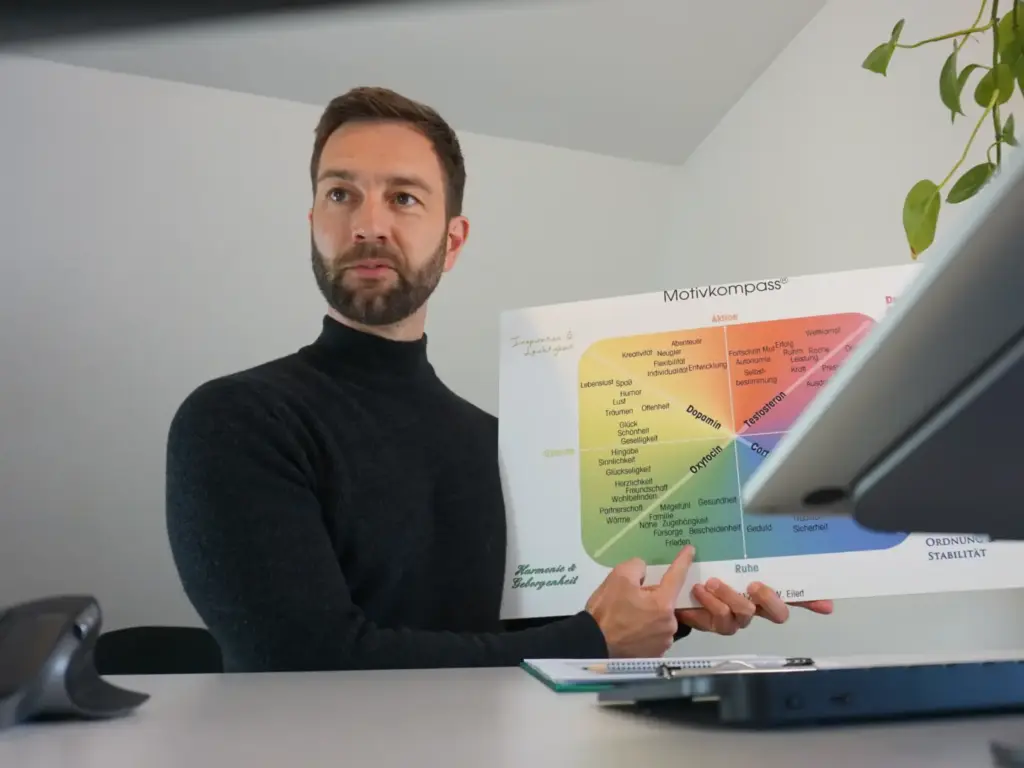Kennst du das? Dein Chef kündigt ein “Coaching-Gespräch” an, und du spürst sofort diese Mischung aus Neugier und Unbehagen. Was erwartet dich jetzt – ehrliche Entwicklungsunterstützung oder verdeckte Leistungsbewertung? Genau hier liegt der Kern eines der spannendsten Führungsdilemmas unserer Zeit. Lass dich inspirieren von diesem Beitrag.
Inhaltsverzeichnis
Als Führungsexperte beschäftige ich mich einigen Jahren mit dieser Gratwanderung. Die Idee klingt zunächst bestechend: Führungskräfte, die nicht nur delegieren und kontrollieren, sondern ihre Mitarbeiter wie professionelle Coaches in ihrer Entwicklung begleiten. Doch funktioniert dieses verlockende Konzept in der Praxis?
Was steckt hinter dem Konzept “Führungskraft als Coach”?
Der Ansatz “Führungskraft als Coach” entstammt ursprünglich dem angloamerikanischen Raum. Dort verschwimmen die Grenzen zwischen Führung und Coaching traditionell stärker als im deutschsprachigen Raum. Die Idee: Führungskräfte nutzen Coaching-Methoden, um das Potenzial ihrer Mitarbeiter zu entfalten und selbstständiges Denken zu fördern, statt nur Anweisungen zu geben.
Die transformationale Führung bildet dabei oft den theoretischen Rahmen. Sie zielt darauf ab, Mitarbeiter zu inspirieren und intrinsisch zu motivieren, anstatt nur über Transaktionen (Arbeit gegen Geld) zu führen. Der coachende Führungsstil passt perfekt in dieses Paradigma – zumindest auf dem Papier.
Doch die entscheidende Frage bleibt: Kannst du als Führungskraft tatsächlich zwei Hüte gleichzeitig tragen?
Führungskraft als Coach: Vorteile und Nachteile
Bevor wir tiefer einsteigen, lohnt ein nüchterner Blick auf die Vor- und Nachteile dieses Konzepts:
Vorteile:
- Direkter Wissenstransfer: Du kennst als Führungskraft die Stärken und Schwächen deiner Mitarbeiter besser als externe Coaches
- Kontinuierliche Entwicklung: Coaching wird Teil des Alltags, nicht nur sporadische Sondersitzungen
- Ressourceneffizienz: Externe Coaches verursachen zusätzliche Kosten
- Kulturwandel: Die gesamte Unternehmenskultur kann sich zu mehr Dialog und Selbstverantwortung entwickeln
- Bessere Beziehungsqualität: Die Beziehung zwischen dir und deinen Mitarbeitern vertieft sich
- Höhere Mitarbeiterzufriedenheit: Mitarbeiter fühlen sich gesehen und in ihrer Entwicklung unterstützt
Nachteile:
- Unauflösbarer Rollenkonflikt: Der strukturelle Widerspruch zwischen Beurteilen und Entwickeln bleibt bestehen
- Double-Bind-Situationen: Mitarbeiter geraten in paradoxe Kommunikationsfallen
- Fehlende Neutralität: Als Führungskraft bist du immer Teil des Systems, nie neutraler Außenbeobachter
- Kompetenzdefizite: Die meisten Führungskräfte besitzen keine fundierte Coaching-Ausbildung
- Gefahr der Grenzüberschreitung: Leichter Zugriff auf persönlichere Themen der Mitarbeiter
- Vertrauensbarrieren: Mitarbeiter öffnen sich seltener komplett bei ihrer beurteilenden Führungskraft
- Kulturelle Passung: Besonders im deutschsprachigen Raum existiert eine größere Distanz zwischen Führungskräften und Mitarbeitern
Die Double-Bind-Falle verstehen
Der vielleicht problematischste Aspekt des “Führungskraft als Coach”-Konzepts ist die sogenannte Double-Bind-Situation. Dieser aus der Psychologie stammende Begriff beschreibt ein Kommunikationsdilemma, bei dem ein Mensch widersprüchliche Botschaften erhält.
Stell dir vor: Als Coach forderst du deinen Mitarbeiter auf, offen über seine Schwierigkeiten zu sprechen. “Hier gibt es keine falschen Antworten,” versicherst du. Doch im Hinterkopf deines Mitarbeiters bleibt die Gewissheit, dass du zugleich seine Leistung bewertest, Gehaltserhöhungen mitbestimmst und über Beförderungen entscheidest.
Er weiß: Jede Schwäche, die er jetzt zeigt, könnte später gegen ihn verwendet werden. Gleichzeitig kann er nicht nicht antworten oder das Dilemma offen ansprechen, ohne als unkooperativ zu gelten. Eine klassische Zwickmühle.
Was die Forschung sagt
Eine aufschlussreiche qualitative Studie von Lange und Webers (2020) zeigt: Besonders Mitarbeiter, die bereits Erfahrungen mit externem Coaching gemacht haben, sowie Mitarbeitervertreter (Betriebsräte) stehen dem Konzept “Führungskraft als Coach” kritisch gegenüber.
Interessant dabei: Mitarbeiter, die nur internes Coaching durch ihre Führungskraft kennen, bewerten dieses durchaus positiv – sie haben schlicht keinen Vergleich zu “echtem” Coaching. Ihr Coaching-Verständnis ist dabei oft deutlich führungs- und verbesserungsorientierter als das professioneller Coaches.
In der Praxis bewerten Führungskräfte ihre eigene Coaching-Kompetenz meist deutlich positiver als ihre Mitarbeiter dies tun. Eine klassische Selbstüberschätzungsfalle, die Raum für Missverständnisse schafft.
Wann Coaching durch Führungskräfte funktionieren kann
Bedeutet all das, dass du als Führungskraft nie coachend agieren solltest? Keineswegs! Entscheidend ist, das “Wann” und “Wie” zu verstehen.
Das Schlüsselkonzept lautet “Problembesitz“. Die Frage lautet: Wer hat das Problem?
- Der Mitarbeiter hat ein Problem: Hier kannst du tatsächlich als Coach agieren. Der Mitarbeiter kommt mit einem Anliegen zu dir, bei dem er Unterstützung wünscht.
- Du als Führungskraft hast ein Problem: Hier musst du klar als Führungskraft auftreten. Beispielsweise, wenn ein Projekt nicht vorankommt oder Absprachen nicht eingehalten werden.
Das GROW-Modell als Struktur für Coaching-Gespräche
Das GROW-Modell ist vermutlich das bekannteste Strukturmodell für Coaching-Gespräche weltweit. Als Führungskraft, die Coaching-Elemente einsetzen möchte, bietet es dir einen klaren Rahmen für entwicklungsorientierte Gespräche. Der Name ist ein Akronym für die vier Phasen des Gesprächs:
G – Goal (Ziel): In dieser Einstiegsphase geht es darum, ein klares Ziel für das Gespräch festzulegen. Frage deinen Mitarbeiter: “Was möchtest du am Ende unseres Gesprächs erreicht haben?” Wichtig dabei: Es geht zunächst um das Gesprächsziel, nicht um langfristige Entwicklungsziele. Ein gutes Ziel ist SMARt: spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert.
R – Reality (Realität): Hier erforschst du mit deinem Mitarbeiter die aktuelle Situation. Was genau ist der Ist-Zustand? Welche Faktoren beeinflussen die Situation? Gute Fragen sind: “Wie sieht die aktuelle Situation konkret aus?” oder “Was hast du bisher bereits unternommen?” Als Führungskraft ist hier besonders wichtig: Fokussiere auf Fragen statt Aussagen und lass den Mitarbeiter selbst die Situation analysieren.
O – Options (Optionen): In dieser kreativen Phase werden mögliche Lösungswege gesammelt. Ziel ist ein breites Spektrum an Handlungsmöglichkeiten, bevor eine Auswahl getroffen wird. Hilfreich sind Fragen wie: “Welche Möglichkeiten siehst du?” oder “Was könntest du noch tun, was du bisher nicht in Betracht gezogen hast?” In dieser Phase ist deine Zurückhaltung als Führungskraft besonders wichtig – lass den Mitarbeiter erst seine eigenen Ideen entwickeln, bevor du eigene Vorschläge ergänzt.
W – Way Forward (Weg nach vorn): Der letzte Schritt konkretisiert die Umsetzung. Hier werden aus den Optionen konkrete Schritte entwickelt: “Was wirst du konkret tun? Bis wann? Welche Unterstützung brauchst du dabei?” Als Führungskraft solltest du hier besonders auf Verbindlichkeit achten, aber dennoch die Eigenverantwortung beim Mitarbeiter belassen.
Das GROW-Modell eignet sich besonders gut für die “Führungskraft als Coach”, weil es einerseits eine klare Struktur bietet, andererseits aber flexibel genug ist, um auf verschiedene Situationen angewendet zu werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt dabei in deiner Grundhaltung: Echte Neugierde, Zurückhaltung mit eigenen Lösungsvorschlägen und der Glaube an das Potenzial deines Mitarbeiters sind entscheidend.
Dabei trittst du tatsächlich in eine coachende Rolle – solange du die folgenden Grenzen respektierst.
Klare Grenzen setzen
Für eine sinnvolle Integration von Coaching-Elementen in deinen Führungsstil solltest du folgende Grenzen beachten:
Bei diesen Themen besser externe Coaches einschalten:
- Karriereentscheidungen, besonders wenn sie das Verlassen des Unternehmens betreffen könnten
- Persönliche Krisen oder tiefgreifende Konflikte
- Situationen, die später von dir bewertet werden müssen
- Themen, bei denen du selbst als Führungskraft Teil des Problems bist
Diese organisatorischen Voraussetzungen sollten erfüllt sein:
- Eine klare Betriebsvereinbarung regelt den Umgang mit internem Coaching
- Führungskräfte erhalten eine Coaching-Ausbildung, nicht nur einen Schnellkurs
- Es existiert ein alternatives externes Coaching-Angebot für Mitarbeiter
- Coaching bleibt freiwillig für die Mitarbeiter
Den kulturellen Kontext beachten
Der kulturelle Kontext spielt eine oft unterschätzte Rolle. Was in den USA funktioniert, passt nicht automatisch in den deutschsprachigen Raum. Der Begriff “Coaching” wird im angloamerikanischen Kontext deutlich breiter verstanden und oft synonym für Führung, Training oder Mentoring verwendet.
Im deutschsprachigen Raum hat sich hingegen ein präziseres Verständnis von Coaching als professionelle Beratungsform entwickelt. Hier wird Wert auf klare Abgrenzung zwischen Führung und Coaching gelegt. Die Führungskraft als Coach bedeutet hier oft nicht mehr als eine “besonders differenzierte Führungshaltung”.
Diese semantische Unterscheidung ist mehr als sprachliche Haarspalterei. Sie spiegelt unser Verständnis professioneller Rollen wider und schafft Klarheit in der Kommunikation.
Praktische Alternativen: Coaching-Elemente in der Führung
Statt dich “Coach” zu nennen, kannst du als Führungskraft wertvolle Coaching-Elemente in deinen Führungsstil integrieren:
- Potenzialentwicklungsgespräche: Regelmäßige, strukturierte Gespräche zur Entwicklung, klar getrennt von Beurteilungsgesprächen
- Dialogorientierte Führung: Offene Fragen und aktives Zuhören als Grundelemente deiner Kommunikation
- Lösungsorientierte Gespräche: Den Fokus auf Lösungen statt Probleme legen
- Ressourcenaktivierende Fragen: Mitarbeiter unterstützen, ihre eigenen Stärken zu erkennen und zu nutzen
- Skalierungsfragen einsetzen: “Auf einer Skala von 1-10, wo stehst du aktuell? Was wäre der nächste kleine Schritt zur nächsten Stufe?”
Diese Methoden benötigen keinen Coach-Titel, sondern zeigen dich als moderne, entwicklungsorientierte Führungskraft.
Fazit: Evolution statt Revolution
Die Idee der “Führungskraft als Coach” verdient weder blinde Begeisterung noch pauschale Ablehnung. Der tatsächliche Wert liegt im differenzierten Umgang mit dem Konzept.
Statt eine Revolution der Führungskultur anzustreben, indem jede Führungskraft zum Coach ernannt wird, lohnt ein evolutionärer Ansatz: Die schrittweise Integration ausgewählter Coaching-Elemente in einen zeitgemäßen, potenzialorientierten Führungsstil.
Der britische Coaching-Pionier John Whitmore träumte einst davon, dass das Wort “Coaching” eines Tages aus dem Lexikon verschwinden möge, weil es einfach zur Art würde, wie wir miteinander umgehen. Ein schöner Gedanke – doch im deutschsprachigen Raum plädiere ich für einen anderen Weg: Die Schärfung des Begriffs Coaching als professionelle Beratungsform.
Als Führungskraft kannst du mitarbeiterorientiert, entwicklungsfördernd und dialogbasiert führen – ohne dich zwingend “Coach” nennen zu müssen. Diese semantische Klarheit schafft Transparenz und Vertrauen, die unverzichtbare Basis jeder erfolgreichen Führungsbeziehung.
Was sind deine Erfahrungen mit dem Konzept “Führungskraft als Coach”? Hast du als Führungskraft oder Mitarbeiter bereits Berührungspunkte mit diesem Ansatz gehabt? Ich freue mich auf deine Gedanken in den Kommentaren!

Du möchtest mehr über das Thema “Führungskraft als Coach” erfahren oder es in deiner Arbeit anwenden?
Melde dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch!
Buchempfehlungen zum Thema Führungskraft als Coach